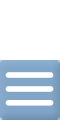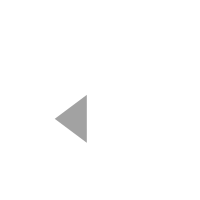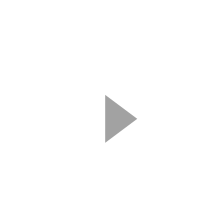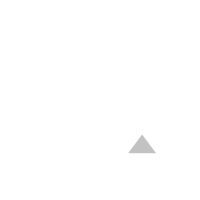VW, bitte mal eine Videobotschaft ohne Teleprompter
Warum es fatal sein kann, Texte zu lesen statt zu sprechen
Auch Claus Kleber hat allabendlich im „heute journal“ (ZDF) Probleme, wenn er seine Texte vom Prompter liest und sich allzu oft verhaspelt. Sei´s drum. Er zählt halt zu den wenigen Profi-Moderatoren, denen es schwerfällt, mit diesem technischen Gerät umzugehen; dem Gerät, das die Texte in die Kamera spiegelt, damit der Moderator konstant in die Kamera gucken und somit den Blickkontakt zum Zuschauer halten kann.
Für Fernsehprofis vor der Kamera ist der Prompter gut und wichtig, ja, notwendig, weil einfach zu viele Informationen transportiert werden müssen. Doch solche Prompter stehen auch in den Kommunikationsabteilungen großer Konzerne. Vorstände sollen ihre Botschaften im geschützten Raum formulieren, nein ablesen – von einem solchen Prompter nämlich.
Dass VW vor Jahren bereits für die Mutter aller Prompter-Negativbeispiele gesorgt hat, als der frühere VW-Chef Winterkorn seine Diesel-Skandal-Botschaft ablas, ist hinlänglich bekannt, aber – und das ist das eigentlich Erschreckende – der Konzern hat aus diesem Kommunikationsdesaster nichts gelernt, denn der Teleprompter für Vorstände ist immer noch nicht aus der Kommunikationszentrale verbannt.
Jüngstes Opfer: Hiltrud Werner, die - wie es in dem Bericht in der Hauptausgabe der „tagesschau“ vom 24. September 2019 heißt – „für die gute Unternehmensführung zuständige Vorstandsfrau“ starrt in die Kamera wie das berühmte Kaninchen in die Augen der noch berühmteren Schlange. Um was zu sagen? Um zu sagen, nein, um abzulesen: „Die Vorwürfe sind unbegründet. Die Volkswagen AG ist dementsprechend weiterhin der festen Überzeugung, alle kapitalmarktrechtlichen Informationspflichten erfüllt zu haben.“ (Es geht um die aktuellen Anklagen gegen die Herren Diess, Pötsch und Winterkorn.)
Das Video startet mit dem VW-Thema bei 06:34, auch wenn das Vorschaubild etwas anderes ankündigt
Erstens: Braucht es dafür eine Videobotschaft?
Das ist doch nicht kompliziert! Das lässt sich auch direkt in die Mikrofone der Journalisten sagen. Ok, bei einer Pressekonferenz werden Nachfragen gestellt, aber das ist ein anderes Thema. Auch das lässt sich regeln. Jedenfalls wäre ein klassisches Presse-Statement authentischer, zugewandter, offener und letztlich imagefördernder gewesen. Wohlgemerkt: Auch wenn der Inhalt der Botschaft kein anderer ist.
Zweitens: WENN Videobotschaft – warum dann mit Teleprompter?
Wer nicht gelernt hat, Texte in der Spiegelung abzulesen, der sollte es lassen. Hiltrud Werner hat es definitiv nicht gelernt. Genau so wenig wie damals Martin Winterkorn. Das Statement wirkt statisch, kaum empathisch, wenig lebendig und völlig undynamisch. Kurz um: Einfach schlecht! Diese Botschaft versandet, kommt nicht an. Jeder Zuschauer spürt, dass Hiltrud Werner gekünstelt wirkt und während der Zuschauer darüber nachdenkt, was ihn stört, ist es auch schon vorbei. WAS hat sie gesagt? Verpasste Chance.
Drittens: Wenn Videobotschaft mit Teleprompter:
Warum nehmen sich die Kommunikationsprofis mit der „Vorstandsfrau für gute Unternehmensführung“ dann nicht so viel Zeit, dass die Videobotschaft nicht nur als Video produziert wird, sondern auch als Botschaft ankommt!?
Das Problem nämlich besteht darin, dass die Entfernung zwischen Kamera und Statementgeber relativ groß sein muss. Der vorbereitete Text wird vor die Linse der Kamera gespiegelt. Aufgrund der Distanz muss die Schrift sehr groß sein. Dies hat zur Folge, dass in einer Zeile maximal 20 Zeichen stehen. Dadurch wird die Lesbarkeit sehr schlecht.
Wir sind nicht gewohnt, so schmale Fließtexte zu lesen. Das Auge springt – beim Buch zum Beispiel - innerhalb einer Zeile von Wort zu Wort. Beim Prompter muss das Auge aber von Zeile zu Zeile springen. Dazukommt: Nur vier bis fünf Zeilen sind gleichzeitig zu sehen. Und: Der Text rollt von unten nach oben. Dies erzeugt das Gefühl, sich beeilen zu müssen.
Summa summarum: Höchste Konzentration wird auf das Lesen des Textes im Prompter gerichtet. Fatale Folge: Die Konzentration aufs Inhaltliche geht nahezu komplett verloren. Der Funke der Botschaft kann nicht überspringen.
Das Learning für alle: Formuliere deine Botschaft in freier Rede – und möglichst mit Leidenschaft, aber wenigstens mit Überzeugungskraft. Nie mit Teleprompter. Dann kann Kommunikation gelingen.
Mit Teleprompter verkommt die Botschaft zur Farce und der Kommunikator läuft Gefahr, gar nicht verstanden zu werden, schlimmstenfalls wird er zur Lachnummer.
Übrigens: Der Zuschauer erkennt bei Ungeübten das Prompterlesen nicht nur an dem starren Blick, sondern auch an den Pupillen. Sie springen hektisch von links nach rechts und von Zeile zu Zeile.
Zur Veranschaulichung der Text, den Hiltrud Werner „dank“ Prompter von unten nach oben rollend so erfassen musste:

Auch wenn ein Interview schief geht, ist noch ´was zu retten
Beim Umgang mit dem „Danach“ zeigt sich der wahre Kommunikationsprofi
Inzwischen liegt das fatal verlaufene Interview zwischen DFB-Präsident Grindel und Florian Bauer, der das Gespräch im Auftrag der Deutschen Welle
führte, einige Tage zurück. Schlagzeilen wie „DFB-Chef rastet aus“ oder „DFB-Boss sorgt für Eklat“ sind passé. Folglich ist der Wirbel um das von
Grindel abgebrochene Interview schon längst „kalter Kaffee“. Manchmal kommt es allerdings darauf an, was mit dem kaltgewordenen Kaffee passiert.
Wird er stehen gelassen, abserviert? Wenn ja – in welcher Form? Elegant oder bleibt er noch Tage unangetastet stehen, bis er Schimmel ansetzt und alles unappetitlich wird?
Auf Grindels Entgleisung bezogen ist die Frage interessant: Wie geht Grindel als Verursacher des Eklats mit dem zerbrochenen Porzellan um?
Antwort: Gar nicht! Zumindest bis dato. Der Zeitpunkt, um noch etwas zu retten, ist inzwischen verstrichen. Die Tasse bleibt zerdeppert und an
den Scherben wird Grindel sich vielleicht in Zukunft noch verletzen.
Kurzer Blick zurück: Florian Bauer führt ein Interview mit DFB-Präsident Grindel. Es geht um die umstrittene Klub-WM, aber auch um einige andere Themen, die zwar nicht zu den Lieblingsthemen des Herrn Grindel zählen, die aber auf der aktuellen sportpolitischen Agenda stehen. Fragen, die gestellt werden sollten. Fragen, mit denen zu rechnen ist. Grindel möchte nur wohlfeile Fragen hören; er insistiert im laufenden Interview, dass andere Fragen gestellt werden sollen. Schließlich sei das ja im Vorfeld anders besprochen worden. Nach einem verbalen Gerangel, weigert sich Grindel zu antworten, steht auf und verlässt den Raum. Abbruch eines Interviews. Grund: Die Fragen waren nicht genehm.
Dass der Befragte seine Antworten bestimmen kann, aber nicht die Fragen, liegt zwar auf der Hand, scheint der DFB-Präsident und frühere ZDF-Reporter aber wohl verdrängt zu haben. Doch dies soll hier gar nicht das Thema sein. Hier geht es vielmehr um die Frage nach dem „Danach“. Ich unterstelle Grindel Positives und gehe davon aus, dass er nur kurz nach seinem „Ausraster“ eingesehen haben wird: Das Verhalten war nicht nur nicht geschickt, sondern auch unhöflich und alles andere als wertschätzend.
Was, wenn ich mich verrenne, wenn ich (zu spät) erkenne, dass ich mich als Interviewpartner in der Öffentlichkeit blamiert habe, dass ich die Institution, der ich vorstehe, Schaden zufüge?
Schweigen? Sicherlich nicht.
Nach dem abgebrochenen Interview gab es Medienanfragen an den DFB: Ob er - oder Grindel selbst - Stellung nehmen wolle? Keine Reaktion. Das heißt, die Medien haben noch goldene Brücken gebaut, doch über eine solche nicht zu gehen, zeugt von Überheblichkeit. Im besten Fall zeugt dies aber auch für das Eingeständnis, einen kommunikativen Fehler begangen zu haben.
Und was ist dann zu tun? In die Offensive gehen!
Ja, öffentlich eingestehen, dass er sich von den Fragen provoziert fühlte, was nicht hätte sein sollen, denn es waren Fragen, die im Raume stehen. Damit hätte Grindel Größe und Kommunikationsfähigkeit bewiesen.
Selbst Profis dürfen Fehler machen; keiner ist unfehlbar. Aber dann die Kurve zu bekommen und sich im weitesten Sinne für das Fehlverhalten zu entschuldigen, wäre angeraten gewesen. Für Verständnis werben in der Öffentlichkeit und um Verzeihung bei Florian Bauer zu bitten. Das wär´s gewesen. Und so? Vertane Chance, Herr Grindel. Das an den Tag gelegte Verhalten lässt den Verdacht wachsen, dass der DFB alles sein möchte, nur nicht transparent, offen, ehrlich und sympathisch.
Hier (oder oben in diesem Artikel) finden Sie den relevanten Teil des Videos.